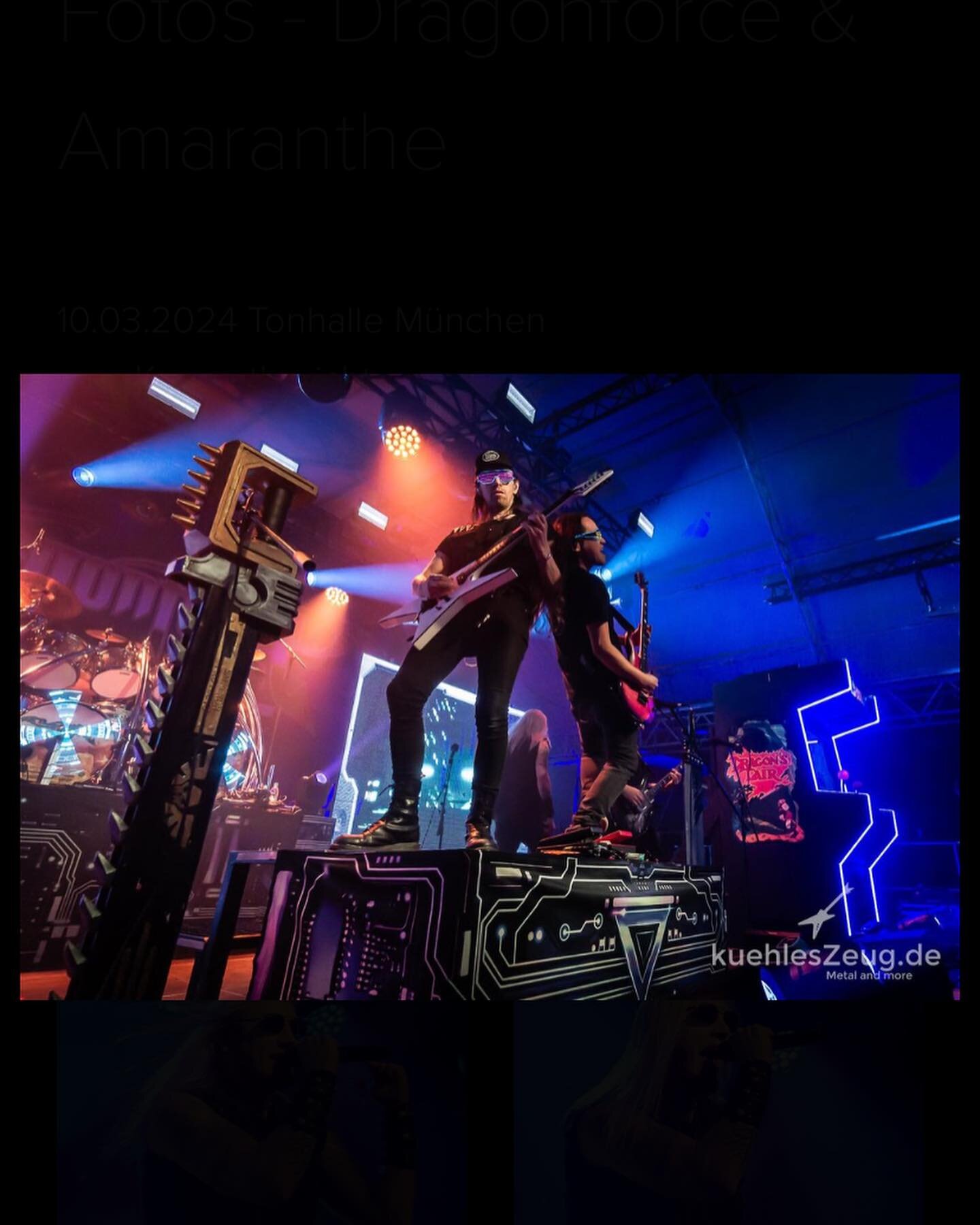Eddie steigt (mit) uns aufs Dach: Iron Maiden führen uns ihr Upgrade vor
/25.07.2025 Frankfurt, Deutsche Bank Park
Um unser Leben mussten wir nicht gerade laufen, aber dennoch: sie waren da, wir waren – natürlich – wieder da, und alle gemeinsam hatten wir Unterschlupf. So traten wir denn ins digitale Maiden-Zeitalter ein – grandios wie immer.
Run for your Lives! Dies war dieses Mal das Motto des Trosses, den Zeremonienmeister Harris schier unermüdlich rund um den Globus schickt. From Iron Maiden to Fear of the Dark, in Klarschrift also nur Material bis 1992 und damit bis zum Ende der ersten Dickinson-Ära, das war die Marschrichtung. Als die Setlist dann publikumswirksam in den einschlägigen sozialen Kanälen Stück für Stück offeriert wurde, schwankte man zwischen Euphorie und minimaler Ernüchterung: lange nicht gehörtes Material wie „Murders in the Rue Morgue“ und (endlich!) „Killers“ entzückte da, ebenfalls die monumentalen Epen „Rime of the Ancient Mariner“ und aus der Prog-Phase sogar „Seventh Son of a Seventh Son“ (noch genauer brauchen wir‘s nicht) – aber dann standen da eben auch nun wirklich nicht mehr essentielle all time Gassenhauer wie „Number of the Beast“, „The Trooper“ und „Fear of the Dark“. Alsbald setzte ein kleines Grummeln in der Anhängerschaft ein, hatte man sich stattdessen doch auf lange nicht bemühte Schätze wie „Prowler“, „22 Acacia Avenue“, „Die With Your Boots On“, „Afraid to Shoot Strangers“ oder vielleicht sogar die spaßigen „Bring Your Daughter To The Slaughter“ gefreut. Nun denn, anstatt des von uns stets liebevoll als Teekanne bezeichneten „Tailgunner“ sollte es dann halt doch wieder „Aces High“ werden. Sei’s drum, die Teilnahme war selbstverständlich doch wieder alternativlos, die Frage stellte sich bestenfalls nach der besten logistischen Herangehensweise. Denn wie stets bei einer Ansetzung der besten Band der Welt gilt nach wie vor das lobenswerte eherne Prinzip: bezahltes Vornestehen gibt’s nicht, wer zuerst kommt, der bekommt das Bändchen, so war es zu erwarten und in den Foren zu lesen.
Insofern gilt die Devise, reichlich früh vor Ort zu sein, was mit dem mittlerweile bewährten Prinzip Parken und Reiten auch trefflich gelingt, um knapp drei Uhr beziehen wir unseren Posten vor den Toren des Waldstadions (den kuriosen neuen Namen sparen wir uns wie immer). Die bange Frage nach den Witterungsverhältnissen – „leichter Regen möglich“, sagen die meteorologischen Anwendungen auf den Schlaufernsprechern – erledigt sich zunächst, wir lassen uns die leichte Wolkendecke durchaus gefallen. Dann geht’s recht pünktlich hinein (nachdem ein Security-Hüne beeindruckend auch ein klemmendes Tor öffnet und die „First to the Barrier“-Kandidaten sich artig aufreihen dürfen), kurzer Sprint in den Innenraum, wo wir dann – Hossa Hossa – das güldene Bändchen in Empfang nehmen. Dieses Mal gibt’s nämlich sogar zwei Early Bird-Areale: gold vorne, und dahinter nochmal eine silberne Zone. Und die weiße Zone, die ist wie immer nicht zum Parken, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir platzieren uns mittig direkt an der Absperrung, so hoffen wir auf beste Sicht und wenig Schubserei (ersteres klappt, zweiteres weniger, später dazu mehr). Zuerst allerdings setzt ein tiefes Grummeln ein, wir denken schon, man habe eine Lüftung eingeschaltet – aber weit gefehlt. Es ist ein apokalyptischer Sturzbach, der sich über das Station ergießt – und uns dank des von Anfang an geschlossenen Dachs erspart bleibt. Wir rufen innerlich ein dreifach Hoch auf die Ingenieurskunst (so schlecht ist die neue Ausführung des Waldstadions dann doch nicht, geben wir ja gerne zu), auch wenn die Wassermassen bisweilen auch durchs Dach tropfen. Wer zu dieser Zeit von draußen reinkommt, ist komplett durchnässt, wir inspizieren auf dem Regenradar die hartnäckige Regenzelle, die irgendwie hier festgeklebt scheint. Egal, irgendwann gegen sieben geht es dann in die erste Runde der Ansetzung. Anstelle von Halestorm, die andere Ansetzungen begleiten, bekommen wir auf diesem Teil der Gastspielreise die gar nicht so alten Schweden von Avatar vorgesetzt. Das mag vielleicht im Rock-Radio laufen, aber das Getöse der Haar-Rotor-Fraktion um Fronter Johannes Eckerström – der zumindest in sehr passablem Deutsch parliert – läuft zumindest bei uns gar nicht gut rein, da hilft auch alles Rockstar-Gepose und The Crow-Schminke nicht mehr. Sei’s drum, ein paar jungen Damen gefallen Nummern wie „In the airwaves“ durchaus. Es sei ihnen gegönnt.
Wir lauschen einstweilen weiter dem Trommelwirbel draußen und fragen uns, wie lange die Dachkonstruktion das wohl mitmacht (sie macht, nichts passiert). Die Bühne selbst begutachten wir auch, nachdem das Avatar-Equickment verräumt ist, erscheint – wenig. Neben zwei Fackeln rechts und links und der obligatorischen Schlagzeug-Aussparung in der Mitte finden sich keinerlei Requisiten (bei der zweiten „Legacy of the Beast“-Runde standen da ja noch die spaßigen Pagoden-Häuschen der Samurai-Welt von Senjutsu), stattdessen erhebt sich eine riesige schwarze Fläche – man munkelte ja im Vorfeld schon von der ersten überwiegend digital untermalten Maiden-Show, nachdem bei der „Future Past“-Gastspielreise zumindest kleinere Videoscreens rechts und links die altbewährten Backdrops umrahmten. Kurz nach acht dann endlich der Moment, der bei jeder Aufführung der Herren für die erste Verzückung sorgt: als „Doctor Doctor“ erklingt, weiß jeder – jetzt geht’s gleich los, man ist ganz hibbelig. Dann erwacht der Screen in der Tat zum Leben, wir huschen zu den Klängen von „The Ides of March“ (immer noch vom Band) durch die Gassen eines fiktiven East Ends. Der Eindruck ist überwältigend, das ist gestochen scharf, die permanente Animation stellt die sonst so liebgewonnen Backdrops naturgemäß in den Schatten – Maiden im upgrade, die Version 2.0 sozusagen. Wie immer kann man über die Detailverliebtheit nur staunen, wir kommen nicht nur an den Ruskin Arms, sondern auch beim Cart & Horses Pub vorbei, wie die damalige Inkarnation 1975 (!) ihr Debüt gab, links geht’s in die Acacia Avenue, ein Handzettel wirbt für ein Konzert mit Praying Mantis und Iron Maiden unter der Ägide von Neal Kay, dem legendären Rock-DJ, der mit seinem Heavy Metal Soundhouse maßgeblich dazu beitrug, die NWOBHM aus der Taufe zu heben und auch Maidens erstem Demo „Soundhouse Tapes“ Anschubhilfe leistete. Ein besonders hübsches Detail für Insider ist ein an die Wand gemalter fahler weißer Kopf, der in den Anfangstagen hinter dem Schlagzeug drapiert war und auf der Debüt-Scheibe auch zu sehen ist - der berühmte „Head“, in feinster Cockney-Intonation „The ‘ead“, aus dem schließlich Eddie wurde. Nun würde ja eigentlich das Backdrop getauscht, in der digitalen Welt scheint dies nicht mehr nötig: flugs wechselt der Hintergrund wie von Zauberhand in einen von finsteren Wolken umsäumten Eiffelturm, und nach einem beschaulichen Intro hat der Zug kann endgültig keine Bremse mehr. „Murders in the Rue Morgue“ geht ordentlich nach vorne, die Kombo stürmt in gewohnter Manier hervor, links Märchenonkel Dave, dann mit dem obligatorischen Stirnband Adrian, Cheffe Steve agiert im simplen schwarzen Tank Top (die West Ham-Shirts finden sich dafür umso zahlreicher im Publikum), Suppenkasper Gers albert herum wie immer. Irritiert sind wir zunächst vom neuen Schlagwerker Simon Dawson, der die Stöcke bekanntlich von Nicko McBrain übernommen hat: während der illustre Vorgänger ja immer noch zweimal zu sehen war (beim Ein- und Aussteigen in sein Schlagwerk), ist Herr Dawson a) nicht barfuß und b) hinter seinem eher überschaubaren Drumkit permanent zu entdecken. Wirbel macht er aber ordentlich, ebenso wie der Derwisch vom Dienst Dickinson, der mit reichlich weißer Mähne daher hüpft und erst einmal in schlichter Lederjacke gemäß den Anfangstagen agiert. Ob er denn nun eine Unterbutz trägt, die Frage beschäftigt die holde Weiblichkeit noch lange nach dem Schlussakkord. Der Sound ist für eine Freiluftveranstaltung (vielleicht hilft das Dach auch hier?) sehr ordentlich, alldieweil: der Song kracht irgendwie nicht. Vielleicht liegt ihnen die Schnelligkeit und Aggression der frühen Tage doch nicht mehr so? Das gleich hinterher gepfefferte „Wrathchild“, zuletzt bei der „Book of Souls“-Tour im Programm, knört da schon mehr ins Kontor. Nun aber wird’s spannend: zumindest ich durfte den Titeltrack des zweiten Albums noch nie live erleben. Die Scheibe spaltet die Fans ja bis heute, für die einen ein Meisterwerk, für die anderen sicherlich die erste Einspielung mit echtem Maiden-Sound, aber doch eher sperrigem Material. Egal, ein wahrlich monströser, axtschwingender Eddie erscheint auf der Leinwand, auch erste bewegte Animationen, dann setzt das dräuende „Killers“-Intro ein. Und das ist – irgendwie träge, der Song kommt nicht aus dem sprichwörtlichen Quark, da hilft auch der erste reale Auftritt von Eddie nicht, der mit Beil und Wuschelmähne über die Akteure herfällt. Bevor uns aber finstere Gedanken beschleichen, treten sie mit einem fulminanten „Phantom of the Opera“ das Pedal endgültig durch. Vor einer gewaltigen digitalen Freitreppe (man wartet dauernd darauf, dass Lon Chaney persönlich als Phantom herunterschreitet) entfaltet sich dieser Song mit seinen Rhythmuswechseln und Stampfparts zu vollem Glanz. Bruce begrüßt uns nun endlich auch einmal, man sei seit geschlagenen 50 Jahren auf dieser Bühne (das nehmen wir symbolisch, die 50 gelten ja nur für Herrn Harris – aber eine lange Zeit ists allemal), und wenn er auf Deutsch zu uns sprechen wollte, hätte er sich bei seiner Schwester ja eine Übersetzung organisieren können (stimmt, Schwesterherz – eine Springreiterin - wohnt offenbar hierzulande, wie uns Teilnehmer unserer Reisegruppe im Vorfeld informiert haben). Wir sind ab jetzt endgültig verzückt, zumal nach einem wie immer versemmelten „Number oft he Beast“ (da nutzen auch alle eingespielten Clips aus „Nosferatu“ nichts) der „Clairvoyant“ – lange Zeit Standard, dann ebenso lange nicht gehört – die Schlachtenbummler zu kollektiven Hüpfattacken und lauthalsigen Mitintonationen animiert, während wir uns erstmals zurück zu den Monsters Of Rock in Schweinfurt 1988 teleportiert wähnen. Wunderbar! Nur wundern kann man sich heute in jedem Falle über die stimmliche Seite der Darbietung: Bruce zeigt sich mehr als nur auf der Höhe, er erklimmt fast alle Klippen mühelos und beweist, dass das Leben mit 66 offenkundig in der Tat erst anfängt. Auf dem Fuße folgt dann eines der absoluten Glanzlichter: selten war „Powerslave“ so gewaltig, übertroffen vielleicht nur von der Pyramide, die dank Animation langsam auf uns zuzurollen scheint. Düster, bedrohlich, höchst atmosphärisch – und Bruce kegelt längst in einer anderen Liga. Großartig! Nun gibt’s die nächste Vollbedienung: zu „2 Minutes to Midnight“ wirft sich der gute Herr Dickinson in seine „Final Frontier“-Kluft, die er offenbar aufgehoben hat, der wie auf dem Cover der Maxi-Single dräuende Eddie beginnt sich zu bewegen – und das tun auch die Schlachtenbummler vor uns, die einen veritablen Moshpit aufmachen. Das ist bei Maiden doch eher ungewöhnlich und drückt uns gehörig gegen die Absperrung – wir kommen darauf zurück. Nun hält der gute Bruce eine kleine Rede darüber, dass man sich doch hüten solle, einem Vogel zu nahe zu treten. Nun, das ist natürlich nur die ganz kurze Interpretation des Epos, das nun folgt: mit dem „Rime of the Ancient Mariner“ legten Maiden 1984 den Höhepunkt ihrer literarischen Ambitionen vor. Mit einer epischen Umsetzung der Ballade des englischen Romantikers Samuel Taylor Coleridge (genau, der mit Kubla Khan, der in Xanadu seinen Pleasure Dome baute), in dem ein Seemann einen Albatros tötet und damit Unheil auf sein Schiff herabzieht
(eigentlich geht es dabei um Naturgewalten, Schuld, Sühne und natürlich wie immer die Kraft der Imagination), lieferten die Herren endgültig den Beweis, dass Metal das Gegenteil von Tod, Teufel und inhaltlicher Dünnbrettbohrerei ist.
Auf der digitalen Leinwand entfaltet sich in den folgenden 15 Minuten eine gewaltige, kinohafte Inszenierung der Geschichte, Bruce huscht in einem geisterhaften Umhang umher, wir erleben, wie der Mariner der Vogel erschießt, das Schiff in eine Flaute gerät („water, water everywhere, and all the boards did shrink, water water everywhere nor any drop to drink“ – wo sonst werden Zeilen eines englischen Romantikers im originalen Wortlaut in ein Fußballstadion geschmettert?), die Mannschaft einer nach dem anderen dem Tod anheimfällt und der Mariner schließlich von einem Geisterschiff gequält wird. Von dem unheilvollen, getragenen Mittelteil inklusive gesprochenen Zeilen („threy dropped down one by one“) geht es in die wunderbar kraftvollen Melodien bis hin zur elegischen Endpassage. Wow. In der Form haben wir das 1984, dann nochmal bei der Maiden England Tour gesehen – aber so kraftvoll und so monumental kam das noch nie. Ganz klar der epische Höhepunkt der Aufführung! Warum wir nun ausgerechnet zum umpfsten Male „Run to the Hills“ serviert bekommen, das fragen wir nicht mehr – der alte Gassenhauer verwandelt das Stadion in einen Schnellkochtopf, die Rammelei nimmt epische Züge an – funktioniert, läuft, bestens. In der epischen Schiene geht es nun mit dem vielleicht proggigsten Ausflug weiter: „Seventh Son of a Seventh Son“ (und noch genauer brauchen wir‘s nicht) strahlt wie seinerzeit und bringt die nächsten seligen Erinnerungen an das Sturzbier in pig city: Bruce schwingt sich und hält die Töne, dass es eine Art hat, das Stück wälzt sich schwer daher und verfängt sich natürlich in der zweiten Hälfte wieder in doch arg proggigen Frickeleien, aber das sind Petitessen: großes Kino. Ab jetzt läuft dann die Maiden-Hitmaschine auf vollen Touren, das alte Schlachtross (sic) „The Trooper“ galoppiert mit den üblichen Versatzstücken (Szenen aus dem „Charge of the Light Brigade“-Film von Michael Curtiz hinten, ein Kavallerie-Eddie vorne) daher, die Meute geht steil, Bruce schwenkt den Union Jack und dann – welch Zufall – eine Deutschland-Flagge. Zum ebenfalls unverwüstlichen „Hallowed be thy Name“ sperrt Bruce sich wie gehabt im Rüschenhemd in einen Käfig und wandert dann – feine Interaktion zwischen digitaler und realer Welt - als Animationsfigur hin zum Galgen, gefolgt von einer Todesfigur. Der melodische Aufbau des Stücks brilliert wie immer, die Gitarrenharmonien strahlen rostfrei. Der Scheunenstürmer „Iron Maiden“ gerät dann etwas hoppelig, das Schlagzeug klingt irgendwie seltsam – und hier ist es irgendwie schade, dass der etatmäßige monströse Eddie (im „Piece of Mind“-Look) nicht mehr als Aufblasfigur, sondern auch als Animation hinter dem Schlagzeug erscheint. Kurze Pause, dann teilt uns ein knorriger Winston Churchill mit: „We will never surrender!“ Ohne Spitfire, dafür aber mit filmreifer Animation eines durch die Lüfte wirbelnden Eddie-Piloten schießt „Aces High“ über uns hinweg, und jeztzt haben wie Faxen endgültig dicke: wir rammeln fröhlich mit und schaffen uns so für die letzten Songs Platz. Äusserst angenehmen – zumal „Fear of the Dark“ (Bruce mit spaßiger Karnevals-Maske und dünnem Lämpchen) das Stadion endgültig in ein Tollhaus verwandelt. „Wasted Years“ gerät da schon fast zum entspannten Mitsingfest, wir sollen safe nach Hause kommen, das tun wir doch gerne. Da am ÖNPV-Anschluss ohnehin erst einmal Ansturm herrscht, bleiben wir ganz entspannt erst einmal am Ausschank auf dem Weg zum Bahnhof stehen. Der serviert nach eigenem Bekunden immerhin den „Best Schobbe in Town“ – das stimmt und kommt uns jetzt äußerst gelegen. Vielleicht kommen sie ja mit der gleichen Inszenierung nochmal zurück, Süddeutschland wurde ja nicht umfangreich beackert – wenn, dann gilt das Motto: da sind wir doch dabei. Es hilft ja nix.